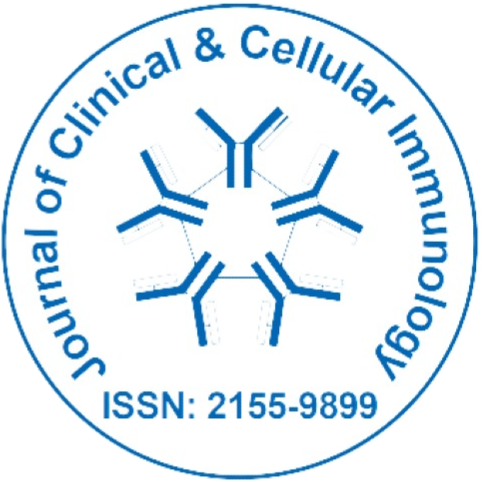
Zeitschrift für klinische und zelluläre Immunologie
Offener Zugang
ISSN: 2155-9899
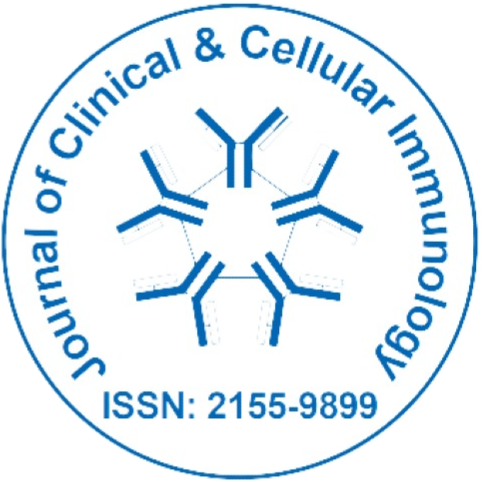
ISSN: 2155-9899
Daniela Bau, Gary Sawers, Anja Wahle, Wolfgang Altermann und Gerald Schlaf
Antikörper, die gegen HLA-Antigene eines bestimmten Spenders gerichtet sind, stellen die häufigste Ursache für hyperakute und akute Abstoßungen dar. Um Empfänger ohne spenderspezifische Antikörper auszuwählen, wurde zunächst der Komplement-abhängige Zytotoxizitäts-(CDC-)Kreuztest etabliert, der bis heute das Standardverfahren darstellt. Sein negatives Ergebnis vor der Transplantation wird derzeit als wichtigste Voraussetzung für ein erfolgreiches kurzfristiges Überleben eines Nierentransplantats angesehen. Als funktioneller Test hängt er jedoch stark von der Verfügbarkeit isolierter Spenderlymphozyten und insbesondere von deren Vitalität ab. Darüber hinaus wurden in den letzten zehn Jahren zunehmend einige Nachteile des CDC-basierten Verfahrens im Zusammenhang mit der hohen Anfälligkeit dieses Tests für Störfaktoren diskutiert, die häufig zu falsch positiven Ergebnissen führen. In diesem Zusammenhang wurde gezeigt, dass mehrere Autoimmunerkrankungen, insbesondere vom Immunkomplextyp (Typ III), oder eine pharmakologische Behandlung eines bestimmten Empfängers zu unerwarteten „falsch positiven“ Ergebnissen des CDC-Kreuztests führen können. Als methodische Alternativen für die anti-HLA-Antikörper-spezifische Kreuzprobe wurden in unserem Gewebetypisierungslabor und denen einiger anderer Gruppen zwei ELISA-basierte Verfahren etabliert: i) der Antibody Monitoring System (AMS-) ELISA und ii) der AbCross-ELISA. Beide Systeme wurden jedoch in den Jahren 2013 bzw. 2016 aus rein kommerziellen Gründen eingestellt. Unter Verwendung desselben Satzes diagnostischer Antikörper wurde der AMS-ELISA, jetzt Donor-Specific Antibodies/DSA genannt, anschließend erneut als mikroperlenbasiertes Array auf der Luminex-Plattform hergestellt. Mit dem Ziel, den DSA-Test als einziges verbleibendes kommerziell erhältliches festphasenbasiertes Kreuzprobensystem zu etablieren, wurde dieses Verfahren in unserem Labor systematisch evaluiert. Vorwiegend, aber nicht ausschließlich aufgrund von Mängeln der Auswertungssoftware, wurden jedoch 69 (32,5%) der virtuell definierten Crossmatch-Ergebnisse (n=212 unabhängige Anti-HLA-Klasse-I- und -II-Spezifikationen bzw. ihre entsprechenden DSA-Tests) mit dem DSA-Test als abweichend klassifiziert, während nur 143 Ergebnisse (67,5%) von der Software dieses Tests als übereinstimmend eingestuft wurden. Bezogen auf die ausgewählte Empfängerkohorte (n=106) sind nicht weniger als 62 (58,4%) von ihnen durch Befunde gekennzeichnet, die durch den virtuellen Crossmatch nicht unterstützt werden. Wir liefern hier den Beweis, dass die Ergebnisse des DSA-Tests im Gegensatz zu denen des AMS-ELISA als seinem Vorgängersystem aus verschiedenen Gründen kritisch hinterfragt werden müssen. Wir kommen daher zu dem Schluss, dass dringend Änderungen durch den Hersteller erforderlich sind, um wieder zu einem System mit ausreichender Validität zu führen, das für die Routinediagnostik jedes Labors verwendet werden kann.